Die Griechen und der Orient – von Homer bis zu den Magiern
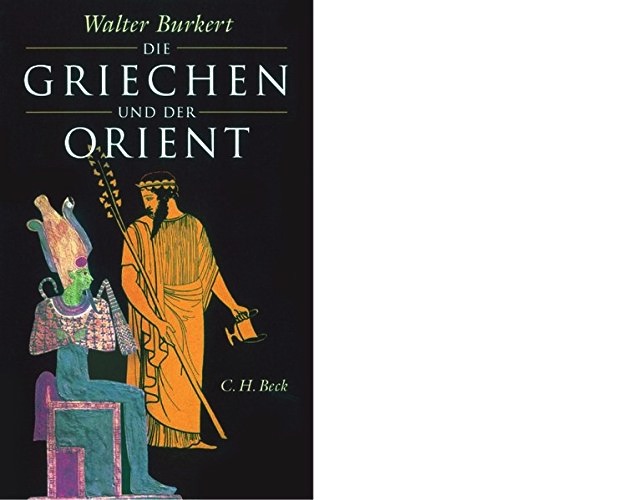
KLASSIKER DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT
DER ORIENT – EIN AUFGELADENES WORT. DER GROSSE KLASSISCHE PHILOLOGE WALTER BURKERT WILL DEN BEGRIFF MIT SEINEM BUCH DIE GRIECHEN UND DER ORIENT – VON HOMER BIS ZU DEN MAGIERN NICHT VERSCHÄRFEN, SONDERN LICHT AUF EINE VIELSEITIG BLÜHENDE KULTURGEMEINSCHAFT WERFEN.
Babylonische Epen, ägyptische Mysterienkulte und persische Magier sind Themen, die viele durch ihre Exotik locken. Walter Burkert, emeritierter Professor der Klassischen Philologie an der Universität Zürich und ausgezeichneter Kenner der klassischen Antike will genau das Gegenteil: Er zeigt auf, dass die griechische Kultur mit diesem exotischen Orient viele Traditionen und kulturelle Merkmale teilt oder sie gar von ihm übernommen hat.
Orient ohne Said
Die Wahl des Orientbegriffs lässt unweigerlich an Edward Saids grosses Werk Orientalism denken. Burkert macht auch gleich in der Einleitung klar: Den Orient als eine Einheit aufzufassen, entstammt einer unhaltbaren westlichen Perspektive. Insofern schliesst er sich Said und den postkolonialen Forschungen an. Burkert geht in seinem Buch jedoch nicht weiter darauf ein, nennt Said auch nicht beim Namen. Auch sonst findet sich in dem Buch nicht viel explizit Geschichtstheoretisches. Die Ursache dafür liegt wohl in der Entstehung des Buches: Es ist die schriftliche Form einer Vortragsreihe, die er 1996 an der Universität Venedig über das Thema früher Kontakte der Griechen mit dem Orient hielt. Es soll eine Einführung sein, eine grobe Übersicht geben über Burkerts umfassende Forschungsarbeiten zum Thema. Darüber hinaus erinnert der Begriff des Orients auch an die in der Kunstgeschichte seit langem so bezeichnete orientalisierende Epoche. Dass die Griechen in dieser Phase der Archaik viele östliche Motive in ihre Kunst übernommen haben, ist lange bekannt. Burkert erweitert in seinem Buch den Umfang dieser orientalisch-griechischen Kulturkontakte.
Eine gemeinsame Kultur
Wie bedeutend und vielseitig orientalische Einflüsse für die griechische Kultur waren, kann Burkert in den fünf Kapiteln auf nur 176 Seiten eindrücklich aufzeigen. Das erste Kapitel (das einzige, das zu den Vorträgen nachträglich hinzugefügt wurde) enthält gleich die weitreichendste Übernahme an Kulturgut: das Alphabet. Aufgekommen ist die Schrift schon zu Beginn des 3. Jahrtausends v. Chr. in Mesopotamien und in Ägypten. Übernommen haben die Griechen ihr Alphabet von den semitischen Phönikern vermutlich um 800 v. Chr. Lange wurde die Einführung der Vokabelschrift den Griechen als grosses Verdienst angerechnet. Burkert widerspricht: Schon vor der griechischen Übernahme zeigten semitische Texte Ansätze der Vokalschreibung. Die Griechen führten bloss Bestehendes weiter.
Im zweiten Kapitel stellt Burkert der frühen griechischen Literatur – also vornehmlich Homer – ältere östliche Werke gegenüber. Das altbabylonische Atrahasis-Epos, das akkadische Gilgamesh-Epos oder das babylonische Enuma elish weisen erstaunlich viele Parallelen zu den griechischen Epen auf. Viele Stellen beispielsweise der Ilias wirken völlig aus dem Kontext des Epos gerissen, kommen aber beinahe wörtlich in orientalischen Werken vor. «Es sieht also fast so aus, als hätte ein bildungswilliger Grieche Anfangsunterricht in orientalischer Literatur genossen.»
Einflüsse aus dem Orient sucht und findet Burkert auch in der Philosophie. Die berühmten griechischen Vorsokratiker wie Heraklit, Anaxagoras oder Protagoras seien keine völlig unbeeinflussten Schöpfer gewesen. Texte über Kosmogonie und Weisheitsliteratur hatten eine weit zurückreichende Tradition im Alten Orient. Auf diese griffen die Vorsokratiker zurück und führten sie weiter. Der berühmtberüchtigte Satz des Pythagoras zum Beispiel findet sich in Keilschrifttexten schon rund 1000 Jahre vor Pythagoras.
Sein viertes Kapitel widmet Burkert der Orphik. Die Orphik ist eine Jenseitslehre, die als eine Strömung des dionysischen Kultes gesehen wird. Sie war ein Mysterienkult und es sind, der Materie entsprechend, wenige Quellen darüber erhalten. Es ist bekannt, dass Eingeweihte in die religiöse Bewegung den mythischen Orpheus als Propheten betrachteten und seine Lehre, die Theogonie des Orpheus, als Weg zum Glück nach dem Tod verwendeten. Nun weisen einerseits die Gottheit Dionysos, andererseits die skandalös-erotischen Bücher des Orpheus und auch der rechte Umgang mit dem Leben nach dem Tod stark in die Richtung Ägyptens. Dies wird umso wichtiger, nimmt man die faszinierende, von Burkert aufgeworfene Frage ernst: Kommen Mysterienkulte wie die Orphik nicht näher an die tatsächlich gelebte Religion der Griechen, als die «klassischen» homerischen Götter? In diesem Fall wäre ein so wesentlicher Teil der Kultur wie die Religion grundlegend von ägyptischen Traditionen durchwachsen.
Über Homer kommt Burkert schliesslich bis zu den Magiern. Die iranischen Magush sind, wie auch sonst das meiste aus Persien zur Zeit der Achämeniden, in Quellen kaum belegt. Was die Ursprünge der Magier waren, lässt sich also nicht erschliessen. Die griechische Kultur hatte das iranische Wort als Magós (μαγός) auf jeden Fall übernommen und bezeichnete damit Wanderpriester, die mit den Göttern direkt in Kontakt treten konnten. Die griechische Naturphilosophie sieht Burkert als Fortführung von Ideen dieser persischen Magie. Seinen Band schliesst Burkert mit Worten, die veranschaulichen, welches Bild er mit ihm heraufbeschwören wollte: die «Gesamtheit einer nahöstlich-mediterranen Koiné».
Ein kulturgeschichtlicher Vergleich
Als Methode, dieser Koiné Farbe zu verleihen, wählt Burkert den Vergleich. Dabei verwendet er viele konkrete Beispiele, die den Text anschaulich und die Argumentation verständlich machen. Seine Überlegungen lassen sich leicht nachvollziehen und erzielen so eine starke Wirkung. Anzurechnen ist Bur- kert, dass er in seiner Darstellung sehr interdisziplinär vorgeht. Die Kulturgeschichte wird angereichert mit literatur- und religionswissenschaftlichen, linguistischen und philosophischen Informationen. Auch in seinen Quellen schränkt sich Burkert nicht ein: Inschriften, kürzlich entdeckte Goldblättchen, Papyri und archäologische Befunde berücksichtigt er genauso wie Textquellen. Sprachlich überzeugt Burkert ebenfalls. Er drückt sich klar und pointiert aus, wobei das erste Kapitel merkwürdig abfällt durch lange, komplizierte Sätze, die vermutlich durch das nachträgliche Hinzufügen des ersten Kapitels entstanden sind. Vor dem Hintergrund, dass Burkert seine ursprünglich italienische Fassung eigenhändig ins Deutsche übertragen hat, lässt sich dieser Mangel entschuldigen. Nicht zu Unrecht hat Burkert 2003, in dem Jahr, als die deutsche Fassung unseres Klassikers erschien, den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa erhalten. Er hat sein im Vorwort gesetztes Ziel erreicht: «der Gelehrsamkeit die Lesbarkeit nicht zu opfern».
Kritisierbar ist der sehr einseitige Erkenntniswert des Buches. Bedacht, das Bild der Kulturgemeinschaft zu zeichnen, lässt Burkert den anderen wesentlichen Teil eines Vergleichs völlig ausser Acht: die Unterschiede. In den Quellen, die Burkert verwendet, fänden sich sicherlich ebenso viele – wenn nicht sogar mehr – Gegensätze wie Gemeinsamkeiten. Hierin liegt die Schwachstelle in Burkerts Argumentation. Wer das Buch jedoch weniger als einen kulturgeschichtlichen Vergleich betrachtet und mehr als eine bewusste Zusammenstellung der kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen den Griechen und dem Orient, hat eine wertvolle Einführung zur Hand.
Ein Klassiker über die Klassik
Ein Klassiker ist das Buch des Klassischen Philologen Burkert, weil es ihm gelingt, die Vorstellung über die Klassik selbst zu durchbrechen. Wie schon der Name Klassische Philologie zeigt, haben die griechische und die römische Kultur in der heutigen akademischen und auch populären Ideenwelt eine klare Sonderstellung inne. «Die Klassik», «die Antike» ist Rom und Griechenland. «Klassiker» sind griechische Philosophen und römische Literaten. Dass gerade ein Wissenschaftler aus den eigenen Reihen der Klassischen Philologie dieses Monopol der Klassik zu stürzen vermag, macht ihn selbst zu einem Klassiker.
Literatur
- Burkert, Walter: Die Griechen und der Orient. Von Homer bis zu den Magiern, München 2003.