Film-Kritik von «Darkest Hour» – bringt Regisseur Joe Wright Licht in die dunkelste Stunde?
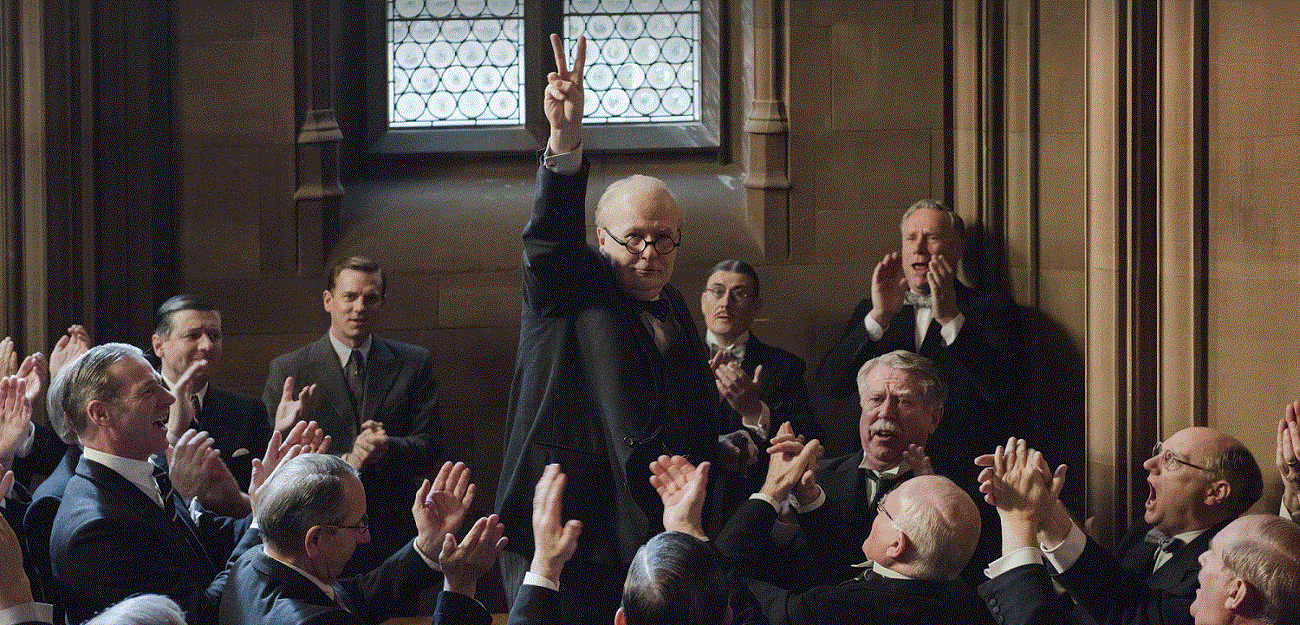
Die etü-Redaktion hatte die Gelegenheit, an einem «Talker Screening» den neuen Churchill-Film Darkest Hour zu sehen, bevor er am 11. Januar in die Kinos kommt. Ein paar Eindrücke und Überlegungen zu einem rhetorisch und emotional geladenen Stück Geschichte.
Nach Jonathan Teplitzkys Churchill und Christopher Nolans Dunkirk ist Joe Wrights Darkest Hour bereits der dritte Film des Jahres 2017, der sich mit der Thematik von Winston Churchills Politik während des Zweiten Weltkrieges befasst. Darkest Hour fokussiert auf Churchills Amtserhebung und seine ersten Wochen als Premierminister, welche vom erfolgreichen deutschen Westfeldzug und Grossbritanniens prekärer Lage, die sich im Mai/Juni 1940 in Dünkirchen sinnbildlich widerspiegelte, geprägt waren.
Gerade bei einem Film, der auf historischen Ereignissen beruht, stellt sich die Frage nach dessen Funktion. In einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift The Atlantic sagt Regisseur Joe Wright (Pride & Prejudice, 2005, The Soloist, 2009, Anna Karenina 2012), er versuche mit Darkest Hour die bronzene Churchill-Statue von ihrem 15 Fuss hohen Sockel zu holen, welche die Engländer ihrem Helden geweiht hätten. Die „Ikone des britischen Nationalismus“ müsse unter die Lupe genommen werden. Dabei stelle er weder Allegorien zur Gegenwart her – immerhin fand im Produktionsjahr 2016 der Brexit statt und die USA erhielten einen neuen Präsidenten –, noch wolle er didaktisch sein. „My job as a storyteller is to present questions, and the audience’s job is to find answers.“ Der Brite Wright ist also mit seiner Selbsteinschätzung als Künstler also irgendwo zwischen Oliver Stones’ (Platoon, JFK, Snowden) Selbstverständnis als Geschichtslehrer und Quentin Tarantinos (Pulp Fiction, Inglorious Bastards, Django Unchained) zu verorten.
Ein neues Bild von Churchill?
Wrights Vorhaben der kritischen Beleuchtung einer historischen, mythisierten Figur lässt das Herzen von (angehenden) HistorikerInnen für einen Moment höherschlagen. Unser Anliegen ist es schliesslich auch, Komplexität nicht zu reduzieren, sondern zu reproduzieren.
Dass das Parlament dem designierten Premierminister Churchill äusserst zurückhaltend begegnete und er gar innerhalb seiner eigenen Partei eine Aussenseiterrolle innegehabt habe, sei für das Publikum wohl überraschend, meint Wright. Tatsächlich gelingt dem Regisseur – und dem hervorragenden Gary Oldman als Churchill –, das „Bulldog-Image“ aufzuweichen, indem sie Churchill als schrulligen, zweifelnden Staatsmann auftreten lassen. Inwiefern sich all dies mit der Darstellung der Quellen deckt, bleibt im Film natürlich ungeklärt. Einziger Hinweis auf den Versuch von faktischer Authentizität ist Wrights Aussage, er habe sich Filmaufnahmen von Churchill angeschaut, was dann doch etwas wenig wäre. Gary Oldman hat diesbezüglich in verschiedenen Interviews mehr verraten: Er hat sich beinahe besessen auf Churchills Reden und ihre eigensinnige Vortragsart vorbereitet.
Eher unbekannt seien auch die Beziehungen zwischen König George VI., Lord Halifax und Churchill, so Wright. Der König habe Lord Halifax für den geeigneteren Nachfolger Chamberlains gehalten. Dies auch deshalb, weil Halifax’ Appeasement-Politik vernünftig erschienen sei, sagt Wright. Dem Regisseur gelingt es im Film – und nicht nur im Interview –, die Rolle des Lord Halifax entsprechend darzustellen: nicht als zu verachtenden Nazi-Kollaborateur, sondern als nüchtern denkender Politiker, welcher das Leben möglichst vieler Soldaten und Zivilisten schützen will. Es muss angefügt werden: Die Reflexion der Filmemacher in der Darstellung des Lord Halifax tut der Tatsache keinen Abbruch, dass sie Churchills „victory at all costs“-Ansatz äusserst heroisch darstellen.
Die anfänglichen Differenzen zwischen George VI. und Churchill sorgen im Film für Lacher. Mit der aussenpolitischen Kehrtwende des Königs und seiner darauffolgenden Unterstützung Churchills wendet sich auch im Film das Blatt: der Zweifler Churchill wird zum Volksversteher und zur Heldenfigur.
Grosse Emotionen, aber keine „emotional truth“
Die künstlerische Leistung des Films liegt in der Erzeugung von Emotionen. Beispielhaft dafür ist etwa die Szene, in welcher Churchill alleine per U-Bahn zum Westminster pendelt und dabei die verblüfften Mitreisenden nach deren Meinung fragt: Soll er mit Deutschland Friedensverhandlungen eingehen oder ohne Rücksicht auf Verluste den militärischen Kampf fortführen lassen? Die Antwort der Bürgerinnen und Bürger fällt einstimmig auf letztere Option. Diese Anekdote hat sich der Regisseur zwar komplett ausgedacht, es sei aber kein unrealistisches Szenario. Als Churchill Stunden später dem Parlament seine „We Shall Fight on the Beaches“-Rede entgegenschmettert, überzeugt er dieses anscheinend ausnahmslos. Der Film endet auf dem emotionalen Höhepunkt.
Der renommierte Filmkritiker Roger Ebert (1942-2013) sprach in Bezug auf Oliver Stones Film JFK (1991) von einer „emotional truth“. Der Film sei authentisch – zwar nicht in Bezug auf die historischen Fakten, dafür aber bezüglich der Darstellung der Gefühle der Nation. Lässt sich das Konzept der emotional truth auch auf Darkest Hour anwenden? Ich wage es zu bezweifeln. Die Heroisierung Churchills, welche auch Wright vornimmt – obwohl er ja ausdrücklich ein kritisches Bild des Staatsmannes zeichnen will –, ist wohl eher im Nachhinein entstanden, nachdem über 300’000 britische Soldaten aus Dünkirchen evakuiert worden waren und nachdem Deutschland fünf Jahre später kapituliert hatte. Denn mit Churchills Rede im Parlament war noch kein einziger Mensch gerettet, kein Krieg gewonnen und die Zukunft nach wie vor ungewiss. Der bei seinem Amtsantritt noch höchst kritisch beäugte Churchill – kritisch beäugt gerade deshalb, weil er für das Debakel bei Gallipoli 1915 verantwortlich gemacht wurde – aufgrund heroischer Kriegsrhetorik als Held seiner Zeit? Schwer vorstellbar.
Geschichte made in Hollywood – was bringt’s?
Wright verspricht zwar, neue Facetten der Person Churchills aufzuzeigen und den Mythos des Nationalhelden zu relativieren. Schlussendlich überwiegt jedoch der Einsatz von emotionaler Heroisierung. Es soll gesagt sein: Diese Emotionen machen den Film durchaus attraktiv und er ist auf weite Strecken fesselnd. Die heroischen Reden haben wohl auf jeden noch so kritischen Zuschauer einen berührenden Effekt – ohne dass man dabei gleich in den Jubel des Parlaments miteinstimmen müsste.
Für HistorikerInnen ist der Film auf mehreren Ebenen interessant und wertvoll. Einerseits regt er zur vertieften Auseinandersetzung mit spezifischen Themen an und rückt vielleicht sogar Themen in den Fokus, welcher sich die Forschung annehmen könnte. Ohne das Forschungsfeld um Churchills Person zu kennen, vermochte der Film mich etwa für die politischen Abläufe, Abhängigkeiten und Netzwerke im britischen Parlament der Weltkriegszeit zu interessieren.
Andererseits ist Darkest Hour ein Teil der Rezeptionsgeschichte Winston Churchills: Weshalb behandeln im Jahr 2017 gerade drei Filme seine Person und Politik und wie tun sie das? Welche Filmbilder werden produziert und vermittelt? Wie verändert der Film die Diskussion über den Zweiten Weltkrieg und über Churchill? Die Geschichtsvermittlung durch Hollywood ist oftmals wirkungsmächtiger als die akademische. Wenn ich an Winston Churchill denke, schiesst mir nun das Bild von Gary Oldman in aufwändiger Maske in den Kopf. In diesem Sinne lohnt es sich auch für professionelle HistorikerInnen, „historischen“ Filmen Beachtung zu schenken.