Mit dem Powerpoint-Vorläufer gegen Überfremdungsangst

Konservativer Inhalt, experimentelle Form: Wie ein ehemaliger Flüchtling mit Tonbildschauen und wirtschaftlichen Argumenten gegen die Überfremdungsangst der 1970er-Jahre ankämpfte – und damit als Unternehmer auch noch Profit machte.
In der Schweiz herrscht Hunger und Armut. Essen ist zu wenig da und Arbeit auch. Alle, die noch jung sind und es vermögen, müssen gehen. Emigrieren, weg von der Erde auf den Planeten Wega, wo sie einfache, aber wichtige Arbeit verrichten: Strassen bauen, Tunnels graben, in Fabriken arbeiten. Gedankt wird ihnen ihr Einsatz mit tiefen Löhnen, hohen Mieten sowie Neid und Missgunst: Diese Menschen, heisst es auf Wega, nehmen Einheimischen die Arbeit weg, machen den Wohnraum knapp, flirten mit den Weganerinnen.
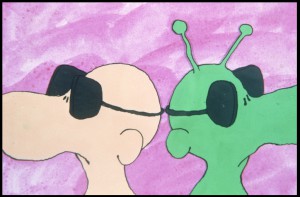
Das ist nicht der Plot eines neuen Science-Fiction-Streifens und auch keine schräge Metapher für die Fremdenfeindlichkeit im heutigen Europa.
Es ist vielmehr der Inhalt einer etwas exzentrischen politischen Informationskampagne für IndustriearbeiterInnen mit dem Titel «Wir in der Schweiz» auf einem unterdessen ausgestorbenen analogen Medium. Und es ist Teil einer frisch digitalisierten Tranche Archivgut im Archiv für Zeitgeschichte (AfZ) in Zürich. (Ähnliches Archivmaterial gibt es auch im Sozialarchiv und im SBB-Archiv.)
«Integrieren statt Isolieren»
Das mittlerweile in Vergessenheit geratene Medium ist das der Tonbildschau – einer Abfolge von per Diashow gezeigten Bildern, zu der eine Tonspur gesprochen wurde. Dem idealen Gefäss für Werbung auf Berufs- oder Produktmessen oder für die interne Schulung von Mitarbeitenden in einer Zeit, in der bewegte Videos teurer Luxus waren.
Diese Zeit, das waren die 1970er-Jahre, als in der Schweiz eine Überfremdungsinitiative die nächste jagte. Und die Kampagne, die mit der weganischen Tonbildschau geführt wurde, richtete sich gegen diese Initiativen. Im Auftrag der Sozialpartner der Maschinen- und Metallindustrie wurde sie erstellt – als Teil einer Serie aus vier Lektionen, mit denen jeweils um die 50 ArbeiterInnen im Rahmen von Kursen konfrontiert wurden. Kursen, für die Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden teils während der Arbeitszeit freistellten.
Alle Lektionen plädieren für die Akzeptanz von Migration und für das «Integrieren statt Isolieren» (so der Titel eines Plakats) von MigrantInnen. Und sie tun dies mit Vorliebe mittels interessanter Metaphern: Neben der von Menschen und Weganern (siehe Abbildung oben) gibt es auch die von der «Schallmauer» des Vorurteils, die jede Verständigung verunmöglicht.
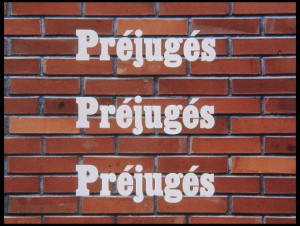
Oder es wird in einer kleinen Geschichtslektion hergeleitet, woher der Reichtum der Schweiz kommt: natürlich aus der Maschinen- und Metallindustrie, wo dank «Erfindungsgeist, Qualitätsbewusstsein, Arbeit» aus einfachem Material Qualitätsgüter für den Export hergestellt werden.
«Wenn ihre Leistung nicht wäre, die Schweiz wäre wohl noch heute (dramatische Pause mit Sprecherwechsel) ein Agrarland, das sich auf seinem kargen Boden nicht selbst zu ernähren vermag. (…) Ein Land, das die Emigration auf andere Art erleben würde, wie auch schon dagewesen», heisst es dramatisch. Denn das ist der Grundtenor der Kampagne: Die Schweiz als Land, das von Export lebt, das sich durch harte und genaue Arbeit Wohlstand schafft, das dafür Arbeitskräfte aus dem Ausland holen muss, wenn es nicht selbst wieder zum armen Auswanderungsland werden will.
Mehr Eingliederung, mehr Produktivität
Integration ist dabei in erster Linie aus volkswirtschaftlichen Gründen nötig: Das «Versäumnis der Eingliederung» schmälert nämlich die Produktivität der Arbeiter. Weil diese so regelmässig wieder gehen, obwohl sie «den Begriff Schweizerischer Qualitätsarbeit eben erst in der Praxis umzusetzen gelernt hatten». Dazu passt, dass in den zum Informationsprogramm gehörenden Kursen auch von Streiks abgeraten wurde.
Ausländer müssen also dabehalten werden, weil sie nur so «schweizerisch» genug gemacht werden können, um «unsere Industrie» zu erhalten. Je angepasster sie sind, desto weniger Ängste lösen sie zudem aus. Da sich die Tonbildschauen ebenfalls an ausländische ArbeiterInnen richteten, können sie auch als Assimilationsaufruf gelesen werden.

Obwohl also klar gegen Überfremdungsängste und Fremdenfeindlichkeit gerichtet, bleibt die Kampagne betont heimatlich. Es geht um das «menschlich Erhalten des Lebensraums» und – in einer Frage-Antwort-Runde zwischen einem besorgten Bürger und einem jovialen Erklärer – um die Beanspruchung der Infrastruktur durch Ausländer: «Sie belasten sie (…) sie zehren an ihr.» Von Umweltschutz über Wohnraum bis hin zur Belegung der Geburtshäuser spiegeln sich alle Überfremdungsängste der Zeit in den Beschwichtigungen und Relativierungen der Sprecher.
Progressives Ziel, konservative Rhetorik
Die Spannung zwischen dem Ziel der Kampagne (Integration von Migranten) und ihrer konservativen Rhetorik, zwischen dem experimentellen Medium der Tonbildschau und ihrem biederen Inhalt macht den Reiz dieser Quellen aus. Und auch die Verbindung von progressiven politischen Zielen mit dem Interesse einer auf billige Arbeitskräfte angewiesenen Industrie sagt viel über den zeitgenössischen state of mind aus.

Zumal sich diese Verbindung auch beim Kopf hinter den Tonbildschauen zeigt: Egon Becker (1926-2006), dessen Nachlass sich im AfZ befindet. Mit seiner Firma «Becker Audio-Visuals» war der KV-Absolvent, gescheiterte Nylonstrumpf-Importeur und ehemalige Fernsehmann auf Gewinn aus, produzierte Material für Coca Cola, Swissair, die Zigarettenindustrie.
Doch Becker war mehr als das: Er war auch ein Tüftler, der ein eigenes technisches Verfahren entwickelte – die Multivision, die als eine Art Powerpoint-Vorläuferin das vollautomatische Bespielen einer Leinwand mittels mehrerer Diaprojektoren erlaubte. Und Becker war selbst ein ehemaliger Migrant – ein Flüchtling, der mit seinen jüdischen Eltern in der Schweiz Sicherheit vor Verfolgung durch die Nationalsozialisten suchte.
Flucht dank «Alibischeidung»
In Danzig geboren floh Becker in den 1930er-Jahren mit seiner Mutter in die Schweiz. Sie hatte durch ihre Heirat mit seinem deutschen Vater ihr Schweizer Bürgerrecht verloren – und konnte es nur durch eine «Alibischeidung» von ihrem Mann wieder zurückerlangen, wie es in einem Lebenslauf heisst, der ebenfalls Teil des Nachlasses ist. Wie die Migranten in Beckers Tonbildschauen musste auch seine Mutter das Geld für sich und ihre Kinder mit schlecht bezahlten Arbeiten verdienen – etwa als Reisende für Wäscheaussteuern. Beckers Vater schaffte es erst kurz vor Kriegsbeginn in die Schweiz, wo er in Flüchtlingslagern leben musste.
Das Schicksal der Eltern, das technische Tüfteln, der Wunsch nach einem eigenen profitablen Unternehmen: All das floss in Beckers Wirken ein – in seine Tonbildschauen und später kurze Dokumentarfilme, die von «Becker Audio-Visuals» in bis zu 120 Ländern emsig vertrieben wurden.
Die Geschichte von Egon Becker und seinen Tonbildschauen ist eine von Profit und Idealismus, von experimenteller Technik mit bürgerlich aufbereitetem progressivem Inhalt – und somit eine durch und durch Schweizerische Geschichte.
Dieser Beitrag entstand im Rahmen eines Kurzpraktikums am Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich. Eine Version davon wurde kürzlich bei ETHeritage publiziert. Dank an Daniel Nerlich und Jonas Arnold für Feedback und Unterstützung.